Читать онлайн Die Enkel des Kolumbus
- Автор: Rüdiger Euler
- Жанр: Биографии и мемуары, Книги о приключениях
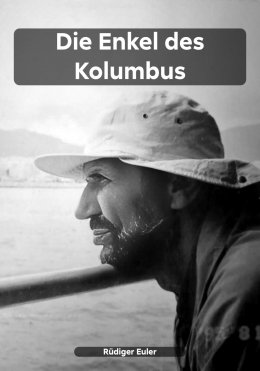
Rüdiger Euler
Umschlagbild: Mónica Vásquez de Euler
Einleitung:
Es steht wohl außer Zweifel, dass Kolumbus in erster Linie Spaß am Entdecken hatte. Seine Entdeckung führte dann jedoch leider dazu Südamerika zu erobern. Im Namen der Krone, des Kreuzes und des lukrativen Goldraubes.
Man könnte seine Entdeckung in gewisser Hinsicht mit der Entdeckung der Atomenergie vergleichen: beides geriet dann in die Hände der Politiker, und Mord und Totschlag konnte beginnen.
In kurzer Zeit hatten die Spanier das geraubte Gold verpulvert, und etwa 300 Jahre später mussten sie Südamerika räumen. Lange Zeit dämmerten sie dann vor sich hin: sie hatten nichts anderes gelernt als aus anderer Leute Taschen zu leben.
Im Geschichtsunterricht hörten wir von großen Feldzügen und Helden: Alexander der Grosse, die Römer, später Napoleon, die Zaren, die Kolonialkriege. Neueren Datums, – ich hörte davon in den 50er Jahren schon nichts mehr im Geschichtsunterricht -, Hitlers Krieg mit seiner Idee vom Lebensraum im Osten, die Japaner in Fernost, und brandneu: der Irakkrieg der US-Amerikaner.
Die Welt ist jedoch dabei sich zu verändern. Die Früchte der militärischen Siege werden immer zweifelhafter. Hitlers 1000 jähriges Reich war recht kurzlebig, Putin sieht in Tschetschenien nicht sehr gut aus, und Bush hofiert händeringend die UNO um sich aus dem Dilemma im Irak wieder herauszuziehen. Das Zeitalter der Eroberungsfeldzüge und Besatzungsmächte scheint vorüber. Selbst „erfolgreiche“ Wirtschaftskriege weiten sich zu Eigentoren aus. Als Thailand und Korea mit finanzpolitischen Machenschaften ruiniert wurden bekam es sogar die internationale Hochfinanz mit der Angst zu tun.
Die Enkel von Kolumbus müssen andere Hausaufgaben machen, um ein besseres Leben genießen zu können. Hochrangige Politiker von Industrienationen besuchen bettelarme afrikanische Staaten (Kanzler Schroeder, 2004) und beschwören sie doch was für ihre Entwicklung zu tun, damit man mit ihnen Geschäfte machen könne.
Die UNO gewinnt an Einfluss, wirtschaftliche Zusammenarbeit ist aktueller denn je!
Meine Welt.
Ich war Anfang der Fünfziger 8 Jahre alt, sensibel und still. Ein braver Junge, aber mit “Eigenleben”. Ich spürte damals mehr als es zu wissen, dass da was schrecklich schief gelaufen war mit meinem Vaterland. Wir lernten Geschichte bis zum letzten deutschen Kaiser. Für die Zeit danach war Funkstille. Die Weimarer Republik wurde gerade noch gestreift.
Die arbeitsfähigen Deutschen verdrängten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Vergangenheit. Sie lebten intensiv die Gegenwart. Arbeit war das Wichtigste. Es gab viel Solidarität untereinander.
Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit waren das Gebot der Stunde. Geld gab´s im Rahmen des Marshallplans. Die Alliierten hatten aus der Geschichte gelernt: den Fehler von Versailles wiederholten sie nicht.
Das Resultat war binnen weniger Jahre ein Wirtschaftswunder in Deutschland. Der zigarrenrauchende dicke Kanzler Ehrhard flößte den Deutschen Vertrauen ein. Damals war es wohl einfacher Kanzler zu sein in Deutschland als heute. Es ging beständig bergauf im Land. Langsam aber sicher kehrte Wohlstand ein.
Aber es war absolut nicht alles in Ordnung in dieser Zeit. Die Deutschen hatten einen schlechten Ruf. Sie waren die bestgehasste Nation der Erde. Sie hatten 40.000.000 Tote auf dem Gewissen, hatten der Welt Elend und Verderben gebracht. Und zuhause? Ich erinnere mich nicht, dass über Hitler oder über den Krieg oder darüber wie die Familie durch all die Jahre gekommen war gesprochen wurde. Meine Schwester bekam da schon mehr mit. Sie war bei Kriegsausbruch 5 Jahre alt, und 1945, auf der Flucht vor den Russen die nach Berlin einmarschierten, war sie schon 11. Sie konnte gut rennen und sich wieselflink in den Straßengraben werfen, wenn die Jagdbomber den Flüchtlingstreck beschossen. Sie erlebte die Bombardierungen Berlins und die Flucht in einprägsamen Bildern, und konnte später zuhause recht gut die Gesprächsfetzen einordnen und sich einen Reim daraus machen, wenn mal etwas über diese Zeit gesagt wurde.
Ich wurde 1942 in Berlin geboren. Wir wohnten in Hermsdorf -, ein Villenviertel im Norden Berlins. Als Säugling, – mein Geburtstag war im Sommer -, verbrachte ich viel Zeit unter den alten Kiefern im Garten hinter dem Haus, erzählte mir meine Mutter. Die Idylle war kurz: schon bald heulten die Sirenen, und meine Mutter hastete mit mir auf dem Arm in den Keller, weil sie dachte sie wäre dort vor den Bomben sicher. Zum Zeitpunkt der Flucht war ich, unglaublich für diese Zeit in der es nichts zu essen gab, ein dickes Baby. Ich aß gerne Grützensuppe, etwas anderes gab es eh nicht. Es wird mir ein Rätsel bleiben wie meine Eltern die Flucht überlebt haben, es schafften mit mir auf dem Arm zu überleben in diesem Inferno. Wie sie mir später erzählten schleppten sie auch noch einen Handkarren mit, voll mit den Sachen die man brauchte. Wo kam eigentlich das Essen her in dieser Zeit? Es gab keine Geschäfte, kein Geld, keine Landwirtschaft, es gab… nichts.
Meinen Bruder hingegen hatte es böse erwischt. Er ist Jahrgang 29 und kam als
16-jähriger, kurz vor dem Zusammenbruch, mit seiner Schulklasse zum Waffeneinsatz gegen die von Westen vordringenden Amerikaner. Die Klasse wurde “aufgerieben”, mein Bruder wurde von einer Kugel aus dem Bord-MG eines Panzers getroffen. Ein Teil seines Rückenmarks wurde zerstört. Später fand ihn mein Vater über Listen des Roten Kreuzes in einem Militärlazarett der Amerikaner. Er war halbseitig gelähmt. Mit eiserner Willenskraft lernte er jedoch sich zu bewegen und zu gehen. Aber die Nervenbahnen waren geschädigt und versagten nach und nach wieder den Dienst. Die letzte Zeit saß er im Rollstuhl, und vor 2 Jahren erlag er den fortschreitenden Lähmungen im Körper. Mein Vater arbeitete vor dem Krieg in der Verwaltung der evangelischen Kirche Deutschlands in Berlin. Dies führte dazu, dass er während des Krieges zur Zivilverwaltung der Stadt Berlin abgestellt wurde. Da er nicht Soldat war bekam er nach dem Krieg sofort Anstellung im Sozialministerium in Rheinland-Pfalz. Zuerst in Koblenz, dann in Mainz. Rheinland-Pfalz war damals französische Besatzungszone. Unser Gymnasium in Mainz war eigentlich mehr ein Trümmerhaufen als ein Gebäude. Ganz Mainz war ein Trümmerhaufen. Die alliierten Bombergeschwader legten Mainz in einer Februarnacht 1945 in Schutt und Asche. Im Keller der Schule gab es ein paar Räume in denen wir unterrichtet wurden. Die Mäuse liefen munter auf den Rohren unterhalb der Zimmerdecke entlang und fesselten unsere Aufmerksamkeit. Obwohl wir im Keller waren tropfte das Regenwasser durch die Decke.Auf dem Schulweg war ein Hotel: der Mainzer Hof. Eines der wenigen Häuser im Mainzer Zentrum welches nicht zerstört war. Manchmal stiegen da Ausländer aus einem Auto und gingen in das Hotel. Ich fand das aufregend. Wenn dies während dem Schulweg passierte blieb ich meist stehen und schaute mir das Schauspiel an. Meine Phantasie arbeitete auf Hochtouren: wo die wohl herkommen?
Zum ersten mal war ich im Ausland als 8 jähriger im Rahmen einer Kinderverschickung, organisiert vom Deutschen Rotem Kreuz. Es ging im Zug über die Alpen, durch die Poebene an die Adria nach Çesenatico, bei Rimini. Zum ersten mal am Meer, zum ersten mal der Anblick der Alpen! Es war überwältigend. Es war das Größte was mir passieren konnte. Alles, alles fand ich unglaublich schön.
Die zweite Gelegenheit Ausland zu erleben ergab sich Jahre später über unser Gymnasium. Unser Englischlehrer, Herr Dirk, war auch der Leiter des deutsch-englischen Jugendclubs in der Schule. Er fragte mich, ob ich im Club mitmachen wollte. Gut dass er mich darauf ansprach: von alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen zu fragen, selbst wenn ich das gedacht hätte. Aber ich fand die Sache natürlich prima! Meine Mutter fand das auch gut. Mein Vater äußerte sich nicht dazu. Wir machten Zeltlager, Bogenschiessen und „Indiaka“ (ein weicher Lederball mit drei Federn) waren unsere Clubsportarten, wir hatten spannende Zusammenkünfte, sangen Lieder und machten uns gegenseitig Julpakete zu Weihnachten. Diese Julpakete sind vielleicht mit den russischen Püppchen vergleichbar: es sind viele Päckchen ineinander, immer mit einem anderen Namen drauf. Wer das letzte Päckchen öffnete war dann der dem das Päckchen gehörte.
Das Aufregenste: unser Club hatte Verbindung mit einem College in Birmingham und dem dortigen englisch-deutschen Jugendclub. Wir konnten interessierte Schüler vom College in Birmingham während der Ferien zu uns einladen, und hatten die Möglichkeit im Austausch nach England zu fahren. Meine Eltern waren mit beidem einverstanden. Mainz war zwar eine Trümmerstadt, trotzdem kam ein Junge aus Birmingham für 2 Wochen zu uns auf Besuch. Mit meinem Englisch klappte das überhaupt noch nicht, mit seinem Deutsch noch weniger. Ich glaube der Junge fühlte sich nicht wohl bei uns. Im nächsten Jahr reisten einige Jungs vom unserem Club nach Birmingham, zusammen mit unserem Englischlehrer. Ich war dabei. Mit dem Englisch war das immer noch eine Katastrophe. Der Aufenthalt bei der Familie in Birmingham war nur kurz, denn die Hauptattraktion der Englandreise war eine Wanderung in der Grafschaft Yorkshire, mit Übernachtungen in Jugendherbergen. Wir wanderten mit den britischen Mädels und Jungs für circa 10 Tage von Jugendherberge zu Jugendherberge, querfeldein, kraxelten über Steinwälle, flüchteten vor wütenden Bullen auf der Weide, verpackten uns in Plastik gegen den ziemlich starken Wind und Nieselregen. Ich hatte eine “Agfa-Box” dabei und machte Fotos. Die Einstellung an der Kamerablende mit dem Sonnensymbol konnte ich vergessen. Das Hebelchen blieb konstant auf “Wolken”. Aber die Gesichter unter dem Plastik waren immer fröhlich. Es war wieder ein unglaublich schönes Erlebnis.
Und da war noch ein anderer “Auslandskontakt”: als Junge hatte ich damals Gelegenheit einige Franzosen kennen zu lernen. Das kam so: mein Vater, Beamter in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz, hatte seinerzeit mit Franzosen zu tun, weil die Hoheitsverwaltung in Rheinland-Pfalz in Händen der französischen Besatzungsmacht lag. Die Franzosen, die diese Aufgabe in Mainz wahrnahmen, sprachen häufig gut Deutsch. Ein Teil ihrer Verwaltung war in der Zitadelle: eine alte Festung auf einem Hügel, mit Blick auf die Stadt und den Rhein. Mein Vater nahm mich mal mit bei einem Besuch auf der Zitadelle: er hatte dort dienstlich etwas mit den Franzosen zu tun. Für mich wurde daraus ein Erlebnis: die Franzosen waren nett zu mir, lachten, ließen mich überall herumlaufen, erlaubten mir sogar in den am Eingang geparkten Kübelwagen zu steigen! Ein Schwimmwagen, der hinten eine kleine Schiffsschraube hatte. Ich bekam zu hören, dass man damit, wenn man wollte, durch den Rhein fahren, konnte! Ich war begeistert.
Es stellte sich heraus, dass die Franzosen regelmäßig auf die Jagd fuhren. Als mein Vater ihnen gelegentlich erzählte, dass die Jagd sein großes Hobby sei, luden sie eines schönen Tages unsere ganze Familie ein zu einem Wochenende auf einer Jagdhütte in den Wäldern bei Kaub am Rhein. Mein Vater bekam einen Jagderlaubnisschein von den Franzosen, und aus den Jagdausflügen entwickelte sich eine jahrelange Freundschaft die noch lange fortbestand, selbst als die Besatzungsmacht wieder nach Frankreich abgezogen war.
Immer noch habe ich meine erste (platonische) Liebe vor Augen: ich war 14 Jahre alt, als es zuhause klingelte. Vor der Tür stand eine bildschöne Französin, vielleicht 20 oder 25 Jahre jung, und fragte nach M. Wonson, von dem sie wusste, dass wir mit ihm befreundet waren. Sie war aus Paris angereist um ihn zu suchen. Mit herrlichem französischen Akzent “sang” sie: “Bonjour, ich bin eine Freundin von
M. Wonson und von Paris hierher ´getreten´ und suche M. Wonson…. “. Während der Zeit der Suche nach M. Wonson wohnte sie bei uns. Ich war fasziniert. Nachmittags gingen wir im verwilderten Park gegenüber unserer Wohnung spazieren, wenn sie da war. Mit unserem Dackel an der Leine. Meine Spielkameraden verstanden die Welt nicht mehr. Ich eigentlich auch nicht.
Nach einigen Tagen fuhr sie wieder nach Paris zurück: M. Wonson war nicht auffindbar. Später erfuhren wir über gemeinsame französische Bekannte, dass er zu dieser Zeit in Afrika war, auf Abenteuertour.
Eigentlich war es so, dass ich damals ein bisschen Angst vor den Franzosen hatte. In der Zeit, als wir für einige Monate in Koblenz wohnten nach dem Krieg, war folgendes passiert: als 7 jähriger Knirps warf ich aus meinem Versteck in den Büschen am Straßenrand Steine auf einen französischen Militärwagen der gerade vorbeifuhr. Was ich mir so gar nicht vorgestellt hatte passierte dann: der Stein traf das Auto, der Wagen bremste scharf ab, zwei Soldaten sprangen heraus und fischten mich aus den Büschen. Sie packten den schlotternden Jungen in den Wagen und nahmen ihn mit zur Militärkommandantur. Dort saß ich dann eine ewige Zeit in einem Zimmer, – vielleicht 10 Minuten -, und dann schickten sie mich böse dreinschauend nachhause. Das war schlimm. Irgendwie fand ich sogar, dass ich da was falsch gemacht hatte.
Danach war bezüglich Kontakten zu Ausländern über 10 Jahre lang absolute Funkstille. Aber ich war bereits “angesteckt”: mir blieb eine Sehnsucht, die mich mein Leben lang nicht mehr los ließ.
Noch etwas stellte sich als wichtig heraus für mich: später pachtete mein Vater die Jagd bei Kaub, mitsamt der dazugehörigen Jagdhütte. Unzählige Wochenende verbrachten wir auf der Jagdhütte bei Kaub, und die vielen Ansitze und Pirschgänge brachten mich dem Wald, der Natur und der Fauna so nahe, dass ich mich ganz natürlich als Teil des Ganzen fühlte.
Es war meinem Vater keineswegs unrecht dass ich Förster werden wollte. Mein Bruder hatte auch die Forstlaufbahn eingeschlagen, nicht zuletzt auf Grund einer Familientradition: mein Groß- und der Urgroßvater waren auch Förster. Wegen seiner Kriegsverletzung blieb mein Bruder in der Bezirksforstverwaltung. Mein Vater (geb. 1906) hatte eigentlich auch Förster werden wollen, aber nach dem 1. Weltkrieg war die Forstlaufbahn für viele Jahre für junge Leute gesperrt, da die Regierung die sogenannten „Zwölfender“ (Soldaten die zwölf und mehr Jahre gedient hatten) im Zuge der Zivileingliederung als Forstbeamte einsetzte. Der Schritt später der Forstverwaltung einen paramilitärischen Status zu geben war dann nicht mehr weit, und im zweiten Weltkrieg rekrutierten sich die Soldaten der Jägerbataillone und der Gebirgsjäger weitgehend aus der Forstverwaltung.
In den 50er Jahren beschlossen die Westmächte Deutschland wieder zu bewaffnen und die Wehrpflicht wurde eingeführt. In den Kriegsszenarien des kalten Krieges war Deutschland damals von der NATO als Schlachtfeld für den 3. Weltkrieg vorgesehen. Die deutschen Soldaten hatten die Aufgabe auf dem Feld der Ehre den Vormarsch der ersten Angriffswellen der Warschauer Paktstaaten zu verlangsamen. Der Zeitgewinn bis zur Vernichtung der Bundeswehr durch die Sowjetarmee war strategisch wichtig um Teil 2 der Abwehrschlacht zu organisieren: Einsatz der alliierten Luftwaffe unter Anwendung der schon im zweitem Weltkrieg erprobten Materialschlachttechniken, diesmal mit Raketenunterstützung. Natürlich musste Teil 2 schnell greifen, damit sich die Front nicht etwa schon jenseits der Westgrenzen Deutschlands installiert hat. Da die Warschauer Pakt – Staaten mit ihren konventionellen Streitkräften eine erdrückende Übermacht hatten musste der Verteidigungsschlag atomar erfolgen. Das Umpflügen von jedem Quadratmeter Erde und allem was darauf war an Sowjetsoldaten, verbliebenen Deutschen, Städten, Wäldern und Feldern hatte in Deutschland stattzufinden.
Meinem Antrag auf Befreiung von der Wehrpflicht wurde nicht entsprochen. Sechs (6) Monate nach meinem Dienstantritt im Forstdienst der Bezirksregierung Neustadt/ Weinstraße wurde ich zum Wehrdienst einberufen. Ich konnte allerdings erreichen, dass ich als Soldat nicht dem Verteidigungsministerium unterstellt wurde, sondern meine Wehrpflicht in der sogenannten Territorialverteidigung abdienen konnte, welche dem Innenministerium unterstellt war.
Meine erste Stelle im Forstdienst war im Forstamt Neustadt-Süd. Mein Chef, Forstdirektor Weber, wusste dass ich an Auslandskontakten interessiert war. Zwei (2) mal wöchentlich bekam ich für ein paar Stunden dienstfrei (holte ich an anderen Tagen nach) um an einem Französischkurs an der Volkshochschule Neustadt teilzunehmen. Die Idee dahinter war mich aktiv in die Kontakte des BdF (Bund der Forstleute) mit der französischen Forstverwaltung und französischen Forstleuten einzubringen. Dazu musste ich natürlich erst mal gut Französisch sprechen lernen. Das fiel mir nicht schwer, denn ich hatte Französisch im Gymnasium ab der Sexta als Pflichtfach, da Rheinland-Pfalz französische Besatzungszone war. Dass ich später einmal mein Französisch in Algerien brauchen würde war zu dieser Zeit noch nicht absehbar… .
Anfang 1967 ging meine 18-monatige Wehrpflichtzeit in Hechtsheim bei Mainz zuende. In dieser Zeit traf in der Kaserne ein Brief für mich ein. Absender: Forstdirektor Weber, Neustadt/ Weinstrasse. Darin teilte er mir mit, dass in der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine Stellenausschreibung für vier (4) Forstleute im Umlauf sei die sich für die Arbeit in einem Forstprojekt in Afghanistan interessieren. Postwendend stellte ich die für die Bewerbung notwendigen Unterlagen zusammen und sendete sie auf dem Dienstweg an die GAWI1 in Eschborn bei Frankfurt, die damals zur Abwicklung von Projekten der deutschen technischen Hilfe im Auftrage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) zuständig war. Ich wurde zu einem Auswahlgespräch in die Bundesstelle für Entwicklungshilfe (BfE) nach Frankfurt eingeladen, und kurze Zeit später traf die Mitteilung ein, dass ich berücksichtigt worden war. Und dies, obwohl ich nicht verheiratet war! Die Stellen waren nämlich für Verheiratete vorgesehen, da Afghanistan als eines der konservativsten muslimischen Länder der Welt für einen Junggesellen etwa so saftig ist wie ein trockenes Stück Holz. Man fürchtete einen Koller und schlechtes Betragen.. .
Nun ja: “guerra avisada no mata gente” sagt man in Quito/ Ecuador, was bedeutet: ein angekündigter Krieg bringt die Leute nicht um.
Die Landesregierung beurlaubte mich für die Zeit meines Einsatzes im Forstprojekt Paktia in Afghanistan unter Fortfall meiner Dienstbezüge, jedoch bei Wahrung aller Beamtenrechte und der Garantie der Wiedereingliederung in den Forstdienst nach Ablauf des Projektes.
_______________________
1 GAWI = “Garantieabwicklungsgesellschaft”, eine ehemalige Kolonialbehörde, in den ersten Jahren mit der Abwicklung der Deutschen Entwicklungshilfe betraut
1967, Afghanistan.
Ich saß in einer Maschine der Lufthansa auf dem Weg nach Kabul. In der Tasche einen Arbeitsvertrag für 2 Jahre als Förster in einem Forstprojekt in den Bergen des Hindukush2. Beim Abschied im Frankfurter Flughafen sagte mir mein Vater: “Also, gut, wenn du unbedingt gehen willst… . Aber komm mir bloß nicht nach einem halben Jahr mit verheulten Augen und eingeklemmten Schwanz zurück. Es ist deine Entscheidung, und das musst du jetzt durchstehen”. Meine Mutter verstand mich wohl besser. Sie lächelte zum Abschied, und wünschte mir viel Glück.Und ich hatte wirklich Glück mit Afghanistan. Das war ein Land… : 100 % nach meinem Geschmack. Die Afghanen fand ich auf Anhieb vertrauenserweckend und angenehm. Stolze Menschen, freiheitsliebend, kultiviert, unglaublich gastfreundlich. Sie lebten in einfachen Verhältnissen: Armut, wie ich sie aus den 50er Jahren von Deutschland her kannte, konnte man das nicht nennen. Alles war ursprünglich, erdig und natürlich.
Die Bergzüge Afghanistans3 ziehen sich im Grossen und Ganzen von Nord-Osten, aus dem Karakorumknoten des Himalajas kommend in Richtung Süd-West. Die Tallagen sind etwa 1500 bis 2000 m hoch, und die höheren Berge haben 5000 bis 7000 Meter; der Tiritschmir, der höchste unter ihnen, ist über 7000 m hoch. In Ostafghanistan begrenzen die Berge nach Pakistan hin das Indusbecken. Insbesondere Nuristan4 im Nordosten Afghanistans und das südlich davon gelegene Paktia erhalten Feuchte von den aus dem Indusbecken Pakistans aufsteigenden Warmluftmassen die sich, wenn sie auf die Kaltluft der Berge stoßen, zu Wolken kondensieren und abregnen. Das ist in einem etwa 100 km breiten Streifen von der Ostgrenze Afghanistans ins Landesinnere hin der Fall. Weiter nach innen hin wird das Klima zunehmend kontinental, mit extrem trockenen und heißen Sommern und sehr kalten Wintern. Das führt mangels Wasser insbesondere im Süd- und Nordwesten Afghanistans zur Wüstenbildung. Einige der heißesten Wüsten der Erde finden sich in Afghanistan. Namen wie Dasht-e-Naomid”5 und “Dasht-e-Margo”6 lassen das erahnen. In den Bergen im Osten des Landes hingegen, mit Sommerregen und ausgiebigen Schneefällen im Winter, wächst Wald. Die wichtigsten Holzarten sind Zedern, Hochgebirgsformen von Fichten und Tannen mit nadelspitzen Kronen, damit der Schnee nicht auf den Ästen liegen bleiben kann und sie abbrechen lässt, eine Weimutskiefernart (Pinus hallepensis), eine Kiefer mit heller Rinde und Samen die die Afghanen geröstet gerne zum Tee knappern (Pinus gelrosa) und die Balluteichen.
_________________
2 daraus wurden dann insgesamt fast 8 Jahre
3 “Afghanistan” heißt “das Land der Afghanen”
4 “Nuristan” heißt das “Land des Lichtes”
5 “ die Wüste der Verzweiflung”, und 6 “die Wüste des Todes”
In Nuristan bordet die Natur regelrecht über: intensives Sonnenlicht, viel Regen und gute Waldböden bringen alles zum Extrem. Extrem hohe und dicke Bäume, wilde Trauben die in die Kronen der Balluteichen ranken, Tannen- und Fichtennadeln, die
so lang sind wie Kiefernnadeln (und länger), Haselnüsse die sich zu Bäumen mit beträchtlichen Stämmen auswachsen. Wasser rauscht durch alle Täler, feuchte Pfade führen in die Hochlagen der Berge wo das Vieh weidet. Dort verbringen die Hirten
den Sommer mit ihren Tieren. Gegen Abend mag da ein Hirte sitzen, unter einem Baum, mit einem fantastischen Blick auf die Kulisse schneebedeckter 5- und 6 Tausender um ihn herum, und spielt ein Lied auf seiner Flöte. Es kann gut sein, das er blonde Haare hat, blaue Augen und eine griechische Nase: Nachkommen der Soldaten Alexander des Grossen, die es satt hatten die Welt zu erobern, sich in den Bergen Nuristans versteckten und beschlossen dort zu bleiben. Das Projektgebiet lag in Paktia, eine landschaftlich ausgesprochen reizvolle Region im Hindukush7. Wir bauten uns selbst unsere Forststation auf, neben dem Dorf Kotgai. Der schneebedeckte Safeth Ko (auf Paschtu: „Spin Ra“, knapp 5.000 m hoch) war unser Hausberg, sozusagen im Vorgarten. Er verdiente seinen Namen zu recht: der weiße Berg. Von Kotgai aus führte der Weg noch ein paar Kilometer weiter bergan, bis zum Fort an der pakistanischen Grenze, in ca. 3000 m Höhe. Von diesen Grenzforts gab es eine ganze Reihe im Projektgebiet. Wir wurden den Grenzkommandanten vorgestellt, weil das Grenzgebiet eigentlich für Ausländer gesperrt war. Unsere Vorstellung gestaltete sich einfach, da unsere Counterparts hohe Militärs waren. Die Regelung unser Counterpartpersonal aus dem Militär zu rekrutieren bot sich an, denn es gab damals keine Forstverwaltung in Afghanistan. Andere jeep-befahrbare Wege existierten nicht im Projektgebiet. Um das Gelände zu erkunden beschaffte ich mir erst einmal ein Pferd. Damit kam ich schnell und sicher in die entferntesten Ecken des Waldgebietes von Mandaher, da es an Nah- und auch Fernpfaden nicht mangelte.
Die Afghanen hatten immer gute Beziehungen zu den Deutschen. Das ging zurück bis in König Amanullahs Zeiten (1919 bis 1929). Als Deutschland den ersten Weltkrieg verloren hatte war König Amanullah der Erste der Deutschland offiziell Staatsbesuch erstattete. Deutschlands verwundeter Volksseele tat das gut. Die Menschen jubelten ihm in Massen zu. In vielen Städten gab es plötzlich “Amanullah-Bars”: Afghanistan war groß in Mode. Vielleicht hatte König Amanullah nicht mit solch einem überwältigend warmherzigen Empfang gerechnet: jedenfalls er war begeistert von den Deutschen, und es wurde ein Kulturabkommen unterzeichnet, wie es vielleicht so weitgehend noch nie in der Geschichte eines gegeben hatte. Es wurde der Bau der Nedjad Oberrealschule in Kabul beschlossen, eine Hochschule für Ingenieurswesen gegründet, und König Amanullah beschloss ganze Schulklassen geschlossen auf ________________________
7 “Hindukush” bedeutet “Hindutöter. Die Inder gaben den Bergen diesen Namen.
Gymnasien nach Deutschland zu schicken, damit sie dort das Abitur machen und danach gleich inDeutschland bleiben um zu studieren. Einer unserer Projektdolmetscher war mit solch einer Klasse in Deutschland. Er begrüßte uns mit den Worten: “na alter Junge, alles in Butter? Prima dass ihr hier seid. Wirklich dufte!” Er hatte in Berlin studiert, und sich vor seiner Rückkehr nach Afghanistan etwas Geld als Taxichauffeur verdient.König Amanullah hätte wohl damals auch einen Assoziierungsvertrag mit Deutschland unterschrieben, wenn es jemandem eingefallen wäre so etwas vorzuschlagen. Das wäre für die Afghanen deshalb akzeptabel gewesen, weil ja alles “in der Familie” geblieben wäre. Wir, die Deutschen, sind nämlich nach Meinung der Afghanen ihre Brüder. In unseren Adern fließt das Blut dergleichen Rasse. Afghanen und Deutsche sind beide Arier. Ein Stamm der, wie sie sagen, vor langer Zeit in Afghanistan lebte.
Hierzu möchte ich eine Geschichte erzählen:
Eine der Aufgaben welche wir uns seinerzeit im Rahmen unserer Arbeit im Forstprojekt Paktia stellten waren Aufforstungen in der Nähe der Gebirgsdörfer, weil die Wälder wegen der laufenden Brennholznutzung um die Dörfer herum inzwischen verschwunden waren, und die Frauen zum Brennholz holen Stunden und Stunden unterwegs waren, mit Körben auf dem Kopf, oder mit Eseln als Lasttiere.
Da blieb eigentlich kaum noch Zeit für die Kleinkinder, die Feld- und Hausarbeit. Und Holz ist in dieser abgeschiedenen Gebirgswelt die einzige Energiequelle zum Kochen, oder zum Wärmen in den bitterkalten kontinentalen Wintern. Die Menschen in den Hindukushtälern leben heute, wie schon vor Tausenden von Jahren, von der Viehzucht und vom Ackerbau. Die Felder in den Tälern werden mit “Djuis” (Wassergräben) bewässert die von den Bergflüssen abgeleitet werden. Ihre Viehherden bestehen hauptsächlich aus Ziegen und Schafen, mit denen sie zur Futtersuche weite Strecken unterwegs sind. Für die Ziegen hauptsächlich wären unsere Aufforstungen Leckerbissen gewesen, wenn man sich nicht um ihren Schutz gekümmert hätte. Was wir im Rahmen unseres Dorfpflanzungsprogramms machten war den “Chan” (der von allen respektierte Chef im Dorf) zu bitten eine “Djirga” (Versammlung) der Dorfältesten einzuberufen, um über den Plan Dorfpflanzungen anzulegen zu sprechen. Ziel der Absprache war mit dem Dorf einen Vertrag abzuschließen, worin das Projekt sich verpflichtete das Pflanzmaterial und die Pflanzgeräte zu stellen sowie den Transport der Pflanzen und die Pflanzarbeit selbst zu organisieren. Das Dorf stellte die Arbeiter zur Durchführung der Pflanzungen, übernahm den Schutz der Pflanzungen und hatte dafür später das exklusive Recht der Holznutzung. Für die Viehherden wurden “Korridore” belassen, um die Möglichkeit zu haben mit den Tieren in die Weidegründe abseits der Pflanzungen zu ziehen. Solche Verträge abzuschließen war einfach, den die Dorfpflanzungen waren begehrt! Es hatte sich im übrigen ja spätestens nach der ersten Djirga in den Gebirgstälern herumgesprochen was wir machten, und die Leute fanden das wirklich gut. Manchmal war es so, dass der Chan im Nachbardorf schon mit den Dorfältesten gesprochen hatte. Wenn wir kamen erhielten wir eine Einladung beim Chan, und ohne spezielle Djirga wurde am gleichen Tag der Pflanzvertrag unterschrieben. Mit Stempelkissen und Daumenabdruck.
Deshalb hatten unsere Versammlungen manchmal mehr den Sinn sich gegenseitig kennen zu lernen, zusammen Tee zu trinken und sich Geschichten zu erzählen. Aber das war mindestens genau so wichtig. Wir saßen in dem Gästezimmer gleich rechts hinter dem Haustor. Die zweite Eingangstür war verschlossen, damit die Gäste (Gäste sind immer Männer, weil Frauen nicht unterwegs sein können um Besuche zu machen) nicht in das Hausinnere schauen konnten, wo sich die Familie bewegt. Das Zimmer hatte die rötlich-braune Farbe des Lehms mit dem die Wand verputzt war. An den spiegelglatten Wänden entlang lagen große Kissen mit farbenfrohen Mustern, und ein großer roter Afghanteppich füllte den ganzen Raum aus. Durch ein kleines Fenster in der dicken Lehmwand fiel Sonnenlicht und erhellte kontrastreich einige Kissen. Wir saßen entspannt auf den riesigen Kissen und warteten auf das Erscheinen des Chans. Dann öffnete sich die grob geschnitzte Holztür, und er kam: ein alter Mann, gekleidet wie alle: ein langes Hemd über der Pluderhose, darüber eine kurze Weste, auf dem Kopf der Turban. Ein langer roter Bart zierte das spitze Gesicht. Natürlich gehörten auch über der Brust gekreuzte Patronengurte dazu, der dazu gehörige Revolver, und der riesige Pashtunendolch im Gürtel. Das war alles unabdingbarer Bestandteil der Kleidung und hatte nicht im mindesten etwas mit einem Misstrauen gegen uns zu tun.
Wir erhoben uns zur Begrüßung und erhielten einen warmen Händedruck. Ein klarer ruhiger Blick erfasste uns, ein unmerkliches Lächeln spielte in seinem faltigen Gesicht. Alle Bewegungen waren gemessen, würdig und stolz. Nach den rituellen Begrüßungsformeln (salemaleikum, zangai, djurli, chai, bachai…) bedeutete uns der Chan mit einer leichten Handbewegung wieder Platz zu nehmen. Mein Counterpart, Herr Navor Shah, sprach fließend Deutsch. So ging die Unterhaltung flüssig; die Übersetzungspausen empfand ich manchmal sogar als angenehm, da man Zeit hatte nachzudenken und zu beobachten während Paschtu gesprochen wurde, und es war leicht eine klare Antwort zu formulieren. Nach einem Jahr hatte ich mich so gut auf Paschtu eingehört, dass ich durchaus mitbekam, wenn etwas nicht gut übersetzt wurde (was bei Navor Shah nie der Fall war), obwohl ich nicht Paschtu sprechen konnte.
Und dann erzählte uns der Chan die viele tausend Jahre alte Geschichte, die alle Afghanen kennen. Wie das mit uns Afghanen war, damals, vor langer, sehr langer Zeit: „.. Die Zeiten waren schwer, weil die Berge nicht mehr alle ernähren konnten. Schnee und Eis kamen immer tiefer die Hänge herab, bedeckte alle Weidegründe, und die Viehherden litten Hunger. Auch das Volk litt Hunger, konnte so in den Bergen nicht mehr überleben. Da beschloss ein Teil des Volkes fortzuwandern, mit den Herden andere Weidegründe zu suchen, um zu überleben. Mehr als die Hälfte von uns wanderte los, nach Nord-Westen. Sie wanderten durch Steppen, Berge, Täler, Wälder, weiter, und weiter.
Das seid ihr, die Deutschen, unsere Brüder, die damals fortgingen. Ihr seid Arier, wie wir. Ihr seid Afghanen. Heute nennt ihr euch “Almaneidas” (Deutsche), aber ihr seid unsere Brüder. Und nun kommt ihr zurück zu uns, um uns zu helfen. Das ist wunderbar, das ist das Schönste, seid willkommen, wir freuen uns sehr!“
Ich war sprachlos. Wir schauten uns an. Das ist also die Geschichte, so wie sie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, von Mund zu Mund, in den Hindukuschbergen, abgeschnitten von der Welt, in diesen Tälern die nie ein Ausländer je vor uns betreten hatte. Ich dachte an die letzte Eiszeit. So war es wohl gewesen, damals, vor 10.000 Jahren, in Afghanistan. Die Berge versanken Jahr für Jahr tiefer in Schnee und Eis, alles erstarrte in Kälte und Frost, und nur die tiefer gelegenen Talsohlen blieben frei.
Was wissen wir über die Geschichte in dieser Zeit in Deutschland? Nichts. Die Mund zu Mund Überlieferung ging bei uns verloren. Andere Hinweise gibt es nicht.
Die Sprache vielleicht: Paschtu ist eine der wenigen Sprachen in der Welt die drei Artikel hat: wie im Deutschen. Beide Sprachen zählen zum Indogermanischen Sprachraum.
Noch etwas verblüffendes: Deutsche und die Afghanen sehen sich ziemlich ähnlich. Blaue und graue Augen sind keine Seltenheit, der Körperbau ist ähnlich. Die Gesichtszüge sind manchmal ziemlich grob, manchmal jedoch sehen sie ausgesprochen gut aus -, ein Umstand der auch für die Deutschen gelten kann. Wenn man von Deutschland mit dem Auto nach Afghanistan fährt sieht man bereits im Balkan völlig andere Gesichter. Auch die kantigen Züge der Türken und dann die glutäugigen Perser sind uns nicht gerade aus dem Gesicht geschnitten. Aber mit den Paschtunen in Afghanistan ist das anders: nach ca. 9000 km Reise!
Und da ist noch was -, so etwas wie ein Volkscharakter: die Afghanen sind direkt, ernst und zuverlässig. Das Wort zählt. Ein Versprechen ist mehr wert als ein Vertrag. Auch das ist in vielen Teilen Deutschlands heute noch der Fall.
Auch hierzu eine Episode:
Ich war mit dem Auto unterwegs im Norden von Afghanistan. In Mazar-i-Sharif entdeckte ich in einem Teppichladen einen herrlichen alten Kelim: ein gewebter Teppich, mit warmen, harmonischen Farbmustern. Er gefiel mir sehr gut, aber er war recht schmal und ziemlich lang. Ich war mir nicht sicher ob die Maße stimmten für den Platz den ich vor Augen hatte in meiner Wohnung in Kabul. Inzwischen konnte ich gut genug Farsi um mich mit dem Teppichhändler zu unterhalten. Wir saßen auf einem Stapel von Teppichen und tranken grünen Tee mit Kardamom. Ich hatte erzählt, dass ich in Paktia in einem Projekt arbeite, und gerade auf Rundreise bin um Afghanistan kennen zu lernen. Da machte mir der Teppichhändler den Vorschlag, ich solle den Teppich mitnehmen, und wenn er mir gefiele in der Wohnung könne ich das nächste mal bezahlen, wenn ich wieder nach Mazar-i-Sharif käme. Ich fragte nach Papier, um ihm meine Adresse zu geben: die bräuchte er nicht.
Ich fragte ob ich etwas anzahlen sollte, – nichts von alledem. Zum Abschied gaben wir uns die Hand und wiederholten noch mal kurz wie wir verblieben waren. Das war alles an Sicherheiten. Erst nach Monaten fand ich Zeit wieder nach “Mazar” zu fahren, mit
Geld um den Teppich zu bezahlen. Der Teppichhändler, das wurde mir klar, hatte nie einen Zweifel dass ich kommen würde um den Kelim zu bezahlen, oder um den Teppich gegebenenfalls zurückzugeben. Er hatte mein Wort. Das genügte ihm vollauf.
Aber, dass sollte man auch wissen: die Afghanen werden zu unversöhnlichen Feinden, wenn sie betrogen und hintergangen werden. Sie finden, wen sie finden wollen. Und sie sind hart, mutig und unerbittlich… .
Das ein Versprechen mehr wert ist als ein Vertrag lernten wir bald auch bei der Projektarbeit:
Für die Dorfpflanzungen schlossen wir mit den Dorfältesten immer schriftliche
Verträge ab. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn wir der GAWI in Deutschland in unseren Halbjahresberichten mitgeteilt hätten wir würden Dorfpflanzungen machen, weil uns die Dorfältesten versprochen hätten die Pflanzungen zu schützen! Nein, in unseren Berichten klang das so: “im Berichtszeitraum schlossen wir soundsoviele Verträge mit soundsovielen Dörfern ab zur Durchführung von dorfnahen Aufforstungen auf soundsoviel Hektar. Dabei kamen die Unterzeichnenden zu folgender Übereinkunft: …“, und so weiter. Das klang gut, so musste das sein, und auch von der Paktia Development Authority (PDA) in Kabul, unserer afghanischen Counterpartbehörde, wurden wir bestärkt so zu verfahren.
Eines schönen Tages bekamen wir jedoch einen Brief vom Landwirtschaftsministerium in Kabul, worin uns knapp mitgeteilt wurde, dass alle Aufforstungen die das Projekt durchführt dem Landwirtschaftsministerium unterstehen. Erlöse aus dem Verkauf des Holzes gehen als Einnahme an das Finanzministerium… .
Das war für das Forstprojekt ein Schlag ins Gesicht, weil in Absprache mit der PDA in allen unseren Verträgen für die Holznutzung und die Einnahmen aus Holzverkauf die Dorfgemeinschaft zuständig war.
Ich dachte ich kann mich nun sicher nicht mehr ins Projektgebiet trauen. Wenn die Paschtunen das erfahren denken sie vielleicht wir seien wortbrüchig und wir hätten sie getäuscht, hintergangen, doppeltes Spiel gemacht mit dem Landwirtschaftsministerium. Nach den ungeschriebenen Regeln der Paschtunen (das Paschtunwali) hätte das bedeuten können, das sie das Projekt nicht mehr akzeptieren und uns das Gastrecht entziehen, wenn nicht noch schlimmeres. Ich besprach das Problem mit meinem Counterpart, Herrn Navor Shah. „Was nun?“ Das war meine bange Frage.
Nun, Herr Navor Shah sah das schon gelassener. Er meinte: keine Angst. Wir fahren in die Dörfer, wir reden mit ihnen. Es wird nichts passieren.
Die erste Dorfversammlung begann, wir zogen den Brief des Landwirtschaftsministeriums heraus und Herr Navor Shah teilte den Dorfältesten mit, dass der vom Projekt mit ihnen abgeschlossenen Aufforstungsvertrag vom Landwirtschaftsministerium ignoriert wird. Der Wald gehöre nicht ihnen, sondern dem Landwirtschaftsministerium. Ein langes Schweigen folgte. Wir schauten uns gegenseitig an. Dann sprach der Chan. Navor Shah übersetzte mir Satz für Satz.
“Hört mir gut zu”, sagte er. “Was bedeutet für uns der Vertrag? Er bedeutet uns nichts. Das ist ein Stück Papier, sonst nichts. Aber wir haben versprochen die Pflanzungen zu schützen. Die Zedern und Kiefern die dort wachsen sind uns. Unsere Kinder und Kindeskinder werden die Bäume für sich nutzen, das gute Holz verkaufen, die Äste und das schlechte Holz als Brennholz nutzen. Dazu fragen wir nicht das Landwirtschaftsministerium. Die Leute die diesen Brief geschrieben haben sind längst gestorben, wenn die Bäume 70 oder 80 Jahre alt sind. Aber unser Dorf wird existieren. Und die Bäume werden existieren, weil wir sie schützen werden.
Wir wissen, dass das Projekt mit uns ist. Wir wissen, das sie nichts mit dem Brief des Landwirtschaftsministeriums zu tun haben.
Was werden wir also tun? Wir wissen von diesem Brief, und das ist alles. Wir werden nichts weiter tun als das was wir beschlossen haben”.
In diesem Moment wurde ich ein Paschtune!
Das Projekt führte Forstwirtschaft auf breiter Ebene ein. Es hatte folgende Komponenten:
– eine Forstschule, zur Ausbildung von Waldarbeitern und Forstfachleuten;
– ein Pflanzennachzuchtprogramm, zur Produktion von Jungpflanzen für die ausgedehnten Aufforstungen;
– eine Forsteinrichtungseinheit, um die vorhandenen Wälder auf ihre Vorräte hin zu erfassen;
– eine Betriebsdienstkomponente: Einrichtung eines Musterforstbetriebes im Waldgebiet “Mandaher”;
– Aufbau eines Sägewerkes, um durch die Vermarktung verkaufsfertiger Holzsortimente Einnahmegewinne zu erzielen;
– Aufbau einer Zentralwerkstatt;
All das war vollkommen neu in Paktia. Nach cirka 5 Jahren waren die vorstehenden Komponenten zufriedenstellend installiert und wurden von qualifizierten afghanischen Fachkräften geleitet. In diese Zeit fiel ein Projektbesuch von seiner Majestät, König Sahir Shah.
Die afghanische Regierung reagierte sehr wohlwollend auf die Projektaktivitäten und beantragte die Erweiterung des Projektes auf die gesamte Provinz Paktia. Paktia ist etwa so groß wie ein durchschnittliches Bundesland in Deutschland.
Eine neue Komponente wurde hierbei erforderlich: agroforstliche Aktivitäten im subtropischen Süden der Provinz Paktia, im Raum von Khost.
Die Forsteinrichtung wurde auf Nuristan ausgedehnt: eine waldreiche Provinz entlang der pakistanischen Grenze, nördlich von Paktia.Wesentlich erweitert wurden die Aufforstungsprogramme in verschiedenen Waldzonen von Paktia.
Und es war nunmehr unumgänglich eine Forstabteilung im Landwirtschaftsministerium in Kabul einzurichten, um die Forstwirtschaft definitiv in Afghanistan zu verankern. Damit kam das Projekt an seine Leistungsgrenze. Insbesondere der letzte Punkt gestaltete sich zähflüssig, denn die Afghanen kamen jetzt in Zugzwang in ihrem Haushalt ein Forstbudget einzuplanen. Bei der knappen Finanzlage hätten hierzu teilweise Mittel der PDA (Paktia Development Authority) abgezweigt werden müssen, was auf Schwierigkeiten stieß. Das Finanzministerium forderte dann die deutsche Seite auf seine Projektmittel über den offiziellen afghanischen Haushalt einzubringen, zur Stärkung des Forsthaushaltes. Das hätte bedeutet, dass die deutschen Steuergelder in den Sumpf der undurchsichtigen Verteilungskanäle des afghanischen Haushalts gelangt wären. Auszahlungen auf der Basis von genehmigten Haushaltsplänen erfolgten meist erst spät im Jahr und hätten sich letztendlich überhaupt nur auf einem Bruchteil dessen eingependelt was an Barem von der deutschen Seite geleistet wurde.
All das führte nach 10 Projektjahren zu einem Patt zwischen den Wünschen der afghanischen Regierung und den Erfordernissen der deutschen Entwicklungshilfe.
Es kam dann so, dass das Paktiaprojekt noch ein Jahr in Eigenregie gezielt besonders förderungswürdige Aktivitäten komplett finanzierte, diese mit Erfolg abschloss und sich dann einvernehmlich im Jahr 1976 aus dem Projekt zurückzog.
Das Forstprojekt Paktia war als technisches Projekt konzipiert worden, hatte als solches Erfolg, und wuchs dann in eine Dimension hinein der es nicht mehr gewachsen war. Das war eine der bitteren Erfahrungen aus der “Gründerzeit” der deutschen Entwicklungshilfe. Das Forstprojekt Paktia war dabei nur eine Komponente des Regionalentwicklungsprojektes Paktia. Bis heute ist es das größte Projekt geblieben welches je im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe durchgeführt wurde. Die Idee dahinter war: klotzen, nicht kleckern. Die Entwicklungshilfe war beseelt von dem Wunsch wirklich etwas ausrichten zu wollen, wirklich dem Land zu helfen. So kam man folgerichtig dazu große Projekte zu konzipieren, da „Entwicklung“ ja ein umfassender Prozess ist, der auf möglichst breiter Ebene das Entwicklungspotenzial der Region abdecken muss, um nicht wie der berühmte Tropfen auf heißem Stein zu verdampfen. Die größte Teilkomponente des Regionalentwicklungsprojektes Paktia war das Landwirtschaftsprojekt, mit Schwerpunkt Obst- und Gemüseanbau. Weitere Komponenten waren ein Schulprojekt, ein Krankenhaus, ein Hoch- und ein Tiefbauprojekt, ein “Wasserprojekt” (Trinkwasserversorgung, Bewässerungsvorhaben, Pumpentechnik) und eine Werkstatt.
Der Fehler in der Projektkonzeption war sicherlich, dass bezüglich der Nachhaltigkeit der Projektwirkungen zwar peinlich darauf geachtet wurde dass jeder deutsche Experte einen möglichst gut ausgebildeten Counterpart hatte der dann später in der Lage war den Experten in der Projektarbeit zu ersetzen. Die institutionelle Verankerung des Projektes durch die lokale Verwaltung und die Ministerien lag jedoch im argen.
Die Projektkonstruktion war auf das afghanische Ansinnen sowohl die Projektsteuerung wie auch die Projektfinanzierung über die Ministerien abzuwickeln in keiner Weise vorbereitet. Das führte dann zu dem knirschenden Kollaps des Regionalprojektes Paktia. Nun darf man aber nicht in den Fehler verfallen zu unterstellen, dass es dem deutschen Projektkoordinator in Kabul, den Verantwortlichen in Eschborn (GAWI) und in der Bundesstelle für
Entwicklungshilfe (BfE) in Frankfurt sowie dem Ressortchef im BMZ an dem notwendigen Überblick gemangelt habe. Man kannte sehr wohl die Ministerien in Kabul. Man kannte sie so gut, das man davor zurückscheute sich in diesen Sumpf zu begeben. Das Personal in den Ministerien wurde so schlecht bezahlt, dass sie davon nicht leben konnten. Folge: Korruption. Es gab keine Schreibmaschinen, kein Papier, auch kein Kohlepapier für Kopien, kein Geld für Aktenordner. Die Vorgänge wurden zwischen zwei Pappdeckeln abgelegt die mit einer Schnur umwickelt waren. Es gab kein Telefon, außer beim Minister. Dort stand auch die afghanische Fahne auf dem Schreibtisch. Eine Fachausbildung auf Verwaltungsebene existierte nicht. Es gab keine Heizung im Winter, – bei minus 20 Grad Außentemperatur. Die Fensterscheiben waren häufig zerbrochen. Die Löcher waren mit Pappstücken oder Brettern oder mit Lappen zugestopft. Die Elektro-Heizspiralen, die eigentlich einmal zum Essenwärmen vorgesehen waren, standen zwar unter einigen Schreibtischen und hätten vielleicht geholfen, – wenn es nicht die Stromausfälle gegeben hätte. Aus ein paar Räumen drang Qualm. Dort glühte auf einem Stück Blech etwas Holzkohle. Da der Strom nicht funktionierte gab es auch kein Licht. Aus den Wasserhähnen lief kein Wasser. Die Toiletten funktionierten natürlich auch nicht. Zu essen gab es nirgends etwas mittags. Zu Jahresbeginn gab es einige Monate auch kein Geld. Die Leute kamen zwar ins Büro, aber ohne Bezahlung, weil das Budget noch nicht freigegeben war. War insofern nicht so tragisch, als der Lohn sowieso ein Witz war. Über all das sprach man wenig. War ja sowieso bekannt. Man sagte nur: oh, das Ministerium! Vergiss es. Da läuft überhaupt nichts. Es war nur folgerichtig zu sagen: wir machen unsere eigene Infrastruktur und machen unser Projekt, Punkt. Hätte man angeboten mit dem Ministerium zu arbeiten hätten allein die Material- und Dienstwagenanforderungen bereits einen wesentlichen Teil des Projektbudgets aufgezehrt, ohne dass bis dahin im Gelände auch nur ein Schritt gemacht worden wäre bezüglich Projektarbeit. Man hätte bei Licht besehen das Ministerium abreissen und neu bauen müssen, die Leute ausbilden -, vernünftige Gehälter und das Budget für das Ministerium bezahlen müssen. So stellte sich seinerzeit die Zusammenarbeit mit dem Ministerium dar. Trotzdem war in der Projektkonzeption, so wie sie war, ein Denkfehler. Logisch durchdacht hätte man sehen müssen, dass die Projektarbeit am Geldtropf der deutschen Entwicklungshilfe hing, und nur solange funktionierte wie dieser Geldtropf zur Verfügung stand. Alle anderen Schlussfolgerungen waren blauäugige Schönfärberei. Wenn aber dieser Verdacht nicht auszuräumen ist, dann darf man nicht auf anderslautenden Annahmen ein riesiges Regionalentwicklungsprojekt aufbauen. Dieses Projekt kostete viel Geld, und es konnte nicht unterstellt werden, dass nach erfolgreicher Übergabe der gut funktionierenden Projektkomponenten aus der Regionalentwicklung ein
“Selbstläufer” wird, dass sich daraus eine Dynamik entwickelt die zu einer blühenden Provinz Paktia führt, mit Modellkarakter für die afghanische Regierung, um dann auf andere Provinzen übertragen zu werden! Wenn ich mit meinen Counterparts über dieses Thema sprach sah ich skeptische Gesichter. Sie arbeiteten gerne mit dem Projekt und fanden es gut.
Sie hatten zum Teil Stipendien in Deutschland erhalten, sie wussten worum es ging. Aber sie sagten, dass ihre Autorität im Projekt direkt mit der aktiven Rolle des Projekts zusammen hing. Sie fürchteten, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Dinge haben werden wenn die Deutschen nicht mehr im Projekt arbeiten. Im Gegenteil: da würde ihnen das Leben sauer gemacht, von denen in den Amtsstuben, die insgeheim neidisch auf sie waren, die sich auch Hoffnungen gemacht hatten einen Dienstwagen vom Projekt benutzen zu können.
Die Counterparts sagten, sie seien dann nicht mehr mobil, weil sie keinen Einfluss darauf haben werden was mit den Dienstwagen passiert. Sicherlich sei es so, dass sich das Ministerium die Dienstwagen holen würde. Aber das sei letztlich auch egal, denn die Dienstwagen wären dann binnen kurzem sowieso nicht mehr einsatzfähig. Wer würde Ersatzteilbestellungen machen, wer würde die Ersatzteile mit welchem Geld bezahlen, wer wird das Benzin bezahlen für die Dienstfahrten? Und überhaupt, die Durchführung der Programme ist doch vollständig von den Deutschen finanziert. Die Arbeiter, die Werkzeuge, die Lastwagen, die Erdbaumaschinen, die Betonmischer, der Zaun, alles! Die ganze Projektinfrastruktur bezahle doch das Projekt. Zum Beispiel das Krankenhaus, die Medikamente, die Gehälter des Pflegepersonals.
“Nein nein, das funktioniert nicht mehr nach der Projektübergabe”, meinten meine Counterparts. Nun, vielleicht war dieser Standpunkt etwas übertrieben. Die Aufforstungen des Projektes haben durchaus eine Chance zu wachsen, und alles was an Ausbildung getan wurde hat sicherlich eine Langzeitwirkung. Das Sägewerk war so konzipiert, dass es sich selbst finanziert. Die Produktion von Obstbäumchen in den Pflanzgärten erfreute sich großer Nachfrage: die Pflanzgärten konnten sich aus Einnahmen vom Pflanzenverkauf selbst finanzieren. Biologischer Flussverbau, Erosionsschutz und viele andere Maßnahmen wurden von den Bauern gerne übernommen und von Ihnen später selbst praktiziert werden. Die Dorfanpflanzungen haben durchaus eine gute Chance zu bestehen, weil die Frauen dafür kämpfen werden sie zu schützen.











